Colorectal Polyp Types: Adenome vs. serratierte Läsionen - Was Sie wissen müssen

Was sind Dickdarmpolypen und warum sind sie wichtig?
Dickdarmpolypen sind kleine, ungewöhnliche Wucherungen an der Innenseite von Darm oder Enddarm. Fast jeder Dritte bis zur Hälfte aller Menschen über 60 hat mindestens einen solchen Polypen - das sagt die American Cancer Society aus dem Jahr 2023. Die meisten sind harmlos. Aber einige können sich im Laufe der Jahre zu Krebs entwickeln. Deshalb ist es entscheidend, sie zu erkennen und zu entfernen, bevor es zu spät ist.
Nicht alle Polypen sind gleich. Es gibt zwei Haupttypen, die medizinisch unterschiedlich behandelt werden: Adenome und serratierte Läsionen. Beide gelten als vor Krebs stehend, aber sie wachsen anders, sehen anders aus und verstecken sich oft unterschiedlich gut bei der Darmspiegelung.
Adenome: Die klassischen Vorläufer von Darmkrebs
Adenome machen etwa 70 % aller Dickdarmpolypen aus. Sie entstehen durch eine Fehlregulation der Zellteilung in der Darmwand. Unter dem Mikroskop zeigen sie eine charakteristische Struktur - meist tubulär, manchmal auch villös oder mischformig.
- Tubuläre Adenome (70 % aller Adenome): klein, röhrenförmig, niedriges Krebsrisiko. Wenn sie kleiner als 0,5 cm sind, liegt das Krebsrisiko unter 1 %.
- Tubulovillöse Adenome (15 %): Mischform. Das Risiko steigt mit dem Anteil an villösen Anteilen.
- Villöse Adenome (15 %): flach, breit, schwer zu entfernen. Sie haben das höchste Krebsrisiko - besonders wenn sie größer als 1 cm sind. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass bereits Krebszellen vorhanden sind, bei 10-15 %.
Größe ist entscheidend. Ein Polyp von 2 cm hat ein viel höheres Risiko als einer von 0,3 cm. Auch die Form zählt: Villöse Anteile erhöhen das Krebsrisiko um 25-30 % im Vergleich zu rein tubulären Adenomen gleicher Größe.
Serratierte Läsionen: Die unauffälligen Täter
Serratierte Läsionen sind weniger häufig - sie machen nur 20-30 % der Polypen aus. Aber sie sind verantwortlich für 20-30 % aller Darmkrebsfälle. Warum? Weil sie schwer zu erkennen sind und oft im oberen Darm, also im Blinddarm oder aufsteigenden Darm, sitzen.
Es gibt drei Arten:
- Hyperplastische Polypen: Meistens harmlos, besonders wenn sie im unteren Darm vorkommen. Ihr Krebsrisiko liegt bei nahezu 0 %.
- Sessile serrate adenomas/polyps (SSA/Ps): Die gefährlichste Form. Sie sehen unter dem Mikroskop wie eine Sägekante aus - daher der Name "serratiert". Sie sind flach, breit und wachsen ohne Stiel. Bei 13 % dieser Polypen findet man bereits hochgradige Vorstufen oder sogar Krebs - fast genauso oft wie bei Adenomen.
- Traditionelle serrate Adenome (TSAs): Seltener, aber auch vor Krebs stehend. Sie haben oft eine erhabene Form und kommen häufig im unteren Darm vor.
SSA/Ps sind besonders heimtückisch. Sie wachsen langsam, verändern sich subtil und entgehen oft der Darmspiegelung. Eine Studie aus 2016 zeigte: 68 % aller SSA/Ps liegen oberhalb der Milzbeuge - genau dort, wo die Endoskopie am schwierigsten ist.
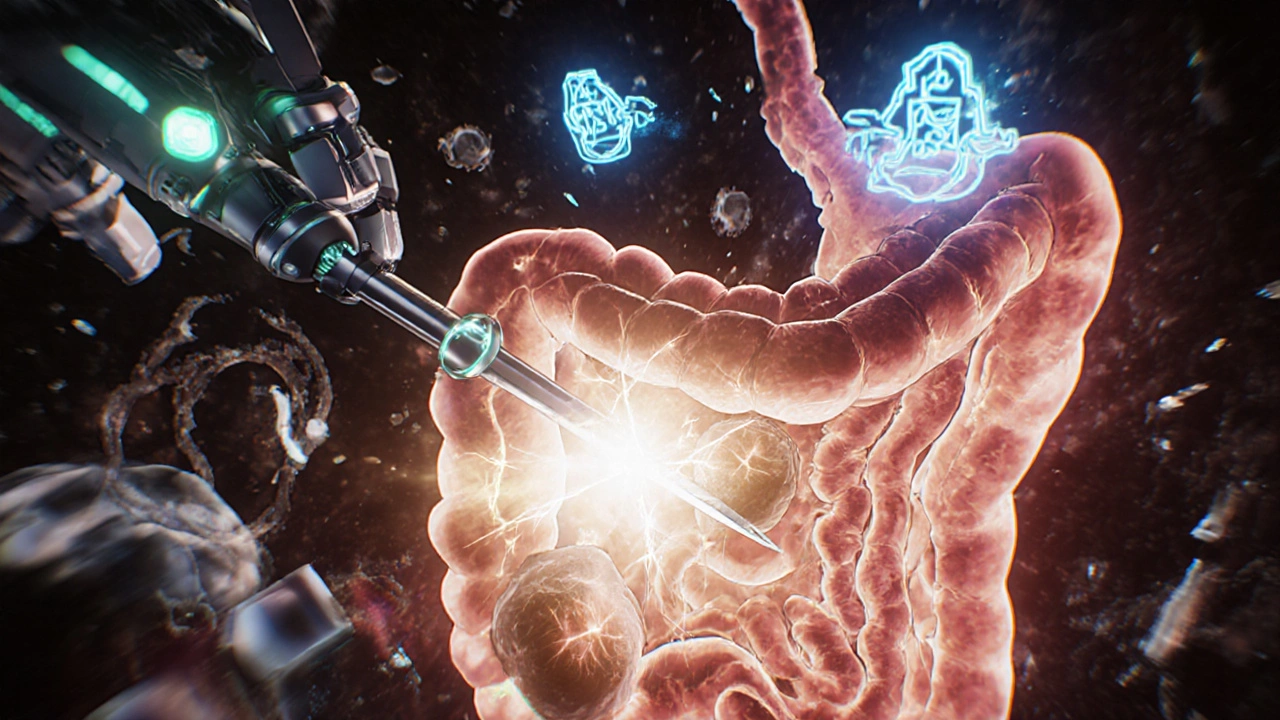
Warum sind serratierte Läsionen schwer zu finden?
Die Form macht den Unterschied. Polypen mit Stiel (pedunkuliert) ragen deutlich in den Darmkanal hinein - sie sind leicht zu sehen und zu entfernen. Sessile Polypen wachsen flach auf der Darmwand auf. Flat Polypen liegen sogar ganz mit der Wand bündig - fast unsichtbar.
Bei sessilen und flachen Polypen liegt die "Miss-Rate" - also die Rate, mit der sie übersehen werden - bei 2-6 %. Das ist doppelt so hoch wie bei polypösen Formen. Besonders bei SSA/Ps ist das ein Problem: Sie haben oft eine matte, gelbliche Oberfläche und keine klaren Ränder. Selbst erfahrene Endoskopiker übersehen sie manchmal.
Neue Technologien helfen. Seit 2022 gibt es KI-gestützte Systeme wie GI Genius, die während der Darmspiegelung live auf den Bildschirm hinweisen, wenn etwas verdächtig aussieht. Studien zeigen: Diese Systeme erhöhen die Erkennungsrate von Adenomen um 14-18 %. Sie helfen auch bei der Erkennung von SSA/Ps - aber nicht perfekt.
Wie wird ein Polyp behandelt?
Die einzige sichere Behandlung ist die vollständige Entfernung während der Darmspiegelung. Das nennt man Polypektomie. Bei kleinen, gut sichtbaren Adenomen unter 2 cm gelingt das in 95-98 % der Fälle.
Bei großen, flachen SSA/Ps ist das schwieriger. Die Erfolgsrate sinkt auf 80-85 %. Warum? Weil sie nicht einfach abgeschnitten werden können - sie müssen mit einer speziellen Technik (wie der EMR oder ESD) abgetragen werden, um alle kranken Zellen zu entfernen. Wenn Teile zurückbleiben, kann sich der Polyp regenerieren und weiterwachsen.
Wichtig: Der Pathologe prüft das entfernte Gewebe. Die wichtigste Frage lautet: Ist der Polyp komplett entfernt? Und enthält er Krebszellen? Wenn ja, muss oft eine weitere Operation folgen.
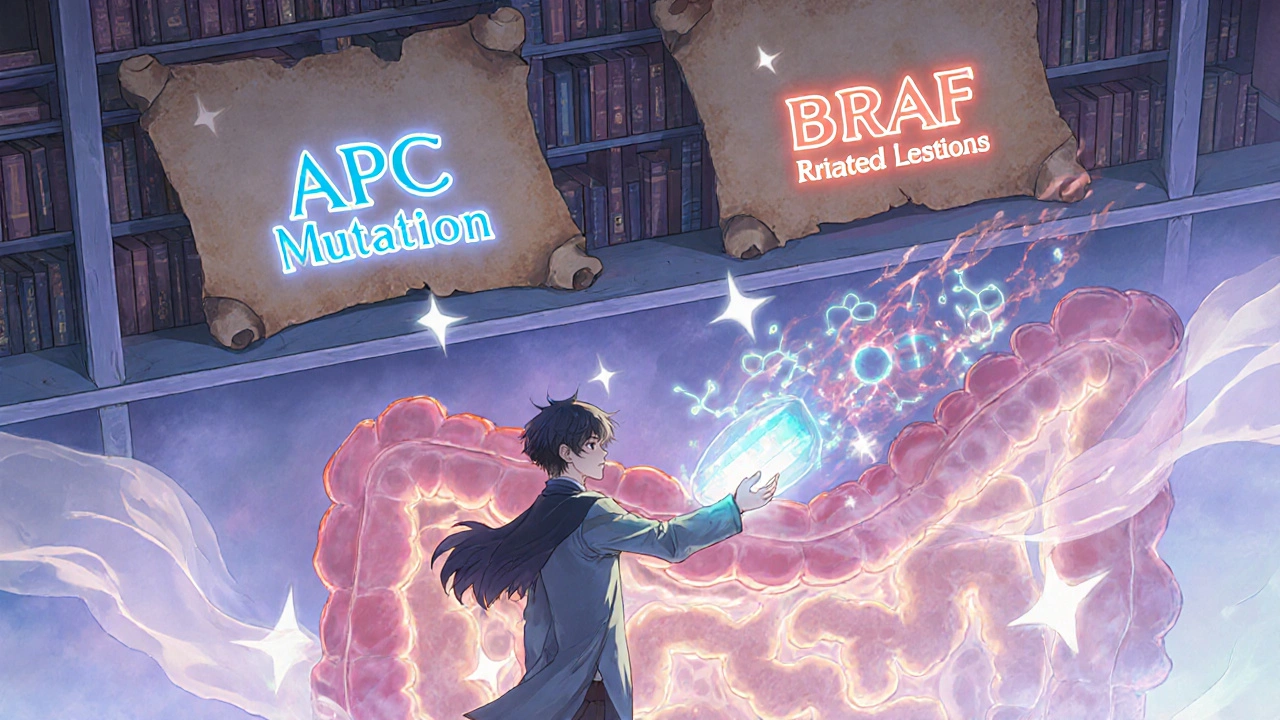
Was passiert nach der Entfernung?
Nach der Polypenentfernung folgt eine Nachsorge. Die Intervalle unterscheiden sich je nach Polypentyp und Größe.
- Bei einem kleinen tubulären Adenom (<1 cm) ohne Hochrisikomerkmale: Wiederholung in 7-10 Jahren.
- Bei einem großen Adenom (>1 cm), mit villösen Anteilen oder Hochgradiger Dysplasie: Wiederholung in 3 Jahren.
- Bei einem SSA/P ≥1 cm: In den USA wird eine Wiederholung in 3 Jahren empfohlen. In Europa, etwa nach den Leitlinien der European Society of Gastrointestinal Endoscopy, reicht oft ein Intervall von 5 Jahren - weil die Progression hier langsamer zu sein scheint.
- Bei mehreren SSA/Ps oder wenn ein SSA/P mit Dysplasie gefunden wurde: Jede 3 Jahre überprüfen.
Wer einmal einen serratierten Polypen hatte, hat ein 1,5- bis 2,5-fach erhöhtes Risiko, später Darmkrebs zu bekommen - aber: Die meisten Menschen mit diesen Polypen entwickeln nie Krebs. Die Entfernung verhindert fast immer den Fortschritt.
Was sagt die Forschung für die Zukunft?
Die Zukunft liegt in der Molekularbiologie. Adenome entstehen meist durch Mutationen im APC-Gen - das ist der klassische Weg. Serratierte Läsionen folgen einem anderen Pfad: Sie zeigen Mutationen im BRAF-Gen und eine starke Methylierung der DNA (CIMP-Phänomen). Diese Unterschiede erklären, warum sie anders wachsen und anders behandelt werden müssen.
Ab 2025 wird es wahrscheinlich Standard sein, Polypen nicht nur nach Form, sondern nach genetischem Profil einzustufen. Forscher arbeiten an Blut- oder Stuhltests, die vorhersagen können, welcher Polyp sich wirklich zu Krebs entwickeln wird. Das könnte die Zahl der unnötigen Nachuntersuchungen um 20-30 % senken - das sind jährlich über 1,3 Millionen Darmspiegelungen in den USA allein.
Ein weiterer Trend: Früherkennung bei jüngeren Menschen. Seit 2010 sinkt die Darmkrebsrate bei über 55-Jährigen - dank Screening. Aber bei unter 50-Jährigen steigt sie jährlich um 2 %. Warum? Vielleicht liegen die Ursachen in der Ernährung, im Mikrobiom oder in genetischen Faktoren. Die Forschung ist noch am Anfang.
Was können Sie tun?
Die beste Vorsorge ist regelmäßige Darmspiegelung. In Deutschland wird sie ab 50 Jahren empfohlen. Wer Risikofaktoren hat - wie familiäre Vorerkrankung, chronische Darmentzündung oder frühere Polypen - sollte früher anfangen.
Wenn Sie Symptome haben: Blut im Stuhl, unerklärliche Anämie, Veränderungen der Stuhlgewohnheiten, Bauchschmerzen - lassen Sie sich untersuchen. Aber: Die meisten Polypen verursachen keine Symptome. Deshalb ist Screening so wichtig.
Kein Polyp ist ein Todesurteil. Er ist ein Warnsignal - und mit der richtigen Behandlung ein vollständig beherrschbares Problem. Die Medizin hat in den letzten 20 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Was früher ein Tumor war, ist heute ein entfernter Polyp - und das ist ein Erfolg.
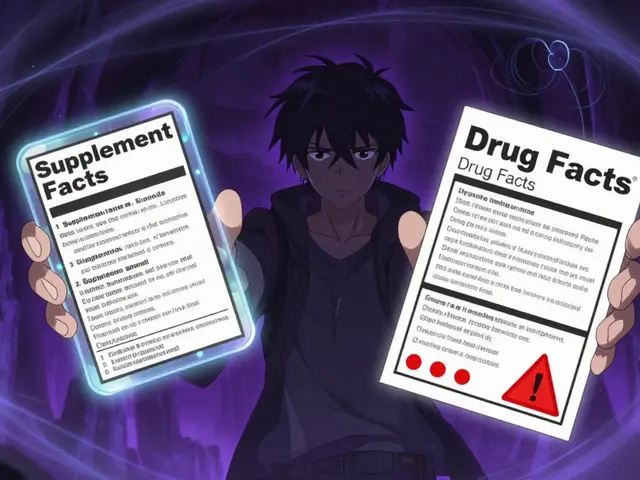
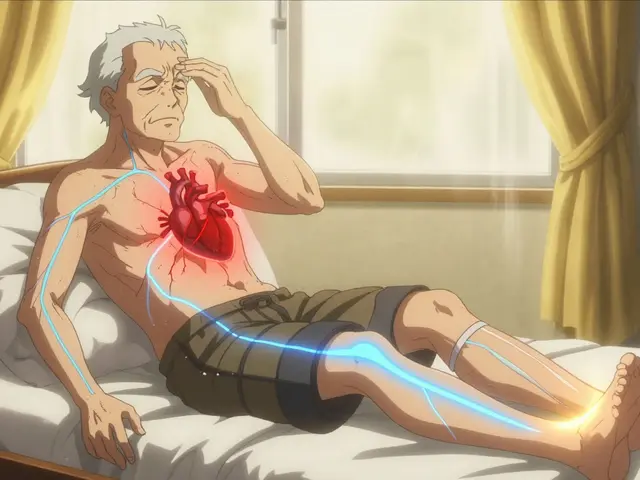



Cherie Schmidt
November 14, 2025 AT 19:53Ronja Salonen
November 15, 2025 AT 02:29Trish Krause
November 15, 2025 AT 17:54Lea Mansour
November 16, 2025 AT 10:10Kerstin Klein
November 16, 2025 AT 22:09hilde kinet
November 18, 2025 AT 18:21max whm
November 19, 2025 AT 19:44Bastian Sucio Bastardo
November 20, 2025 AT 10:32Jim Klein
November 21, 2025 AT 04:55Marion Fabian
November 21, 2025 AT 12:38Astrid Segers-Røinaas
November 22, 2025 AT 14:22Alexander Monk
November 24, 2025 AT 12:31Timo Kasper
November 25, 2025 AT 17:56Sonja Villar
November 26, 2025 AT 12:36Greta Weishaupt
November 27, 2025 AT 17:44